Forschungscampus InfectoGnostics
„Du kochst nicht nur in deiner eigenen Suppe“
Wenn aus Forschungsergebnissen Produkte werden können, sind Professor Ralf Ehricht und Katrin Frankenfeld glücklich. Sie arbeiten beim Forschungscampus InfectoGnostics zusammen an Schnelltests, mit denen sich der Impfstatus oder Antibiotikaresistenzen bestimmen lassen.
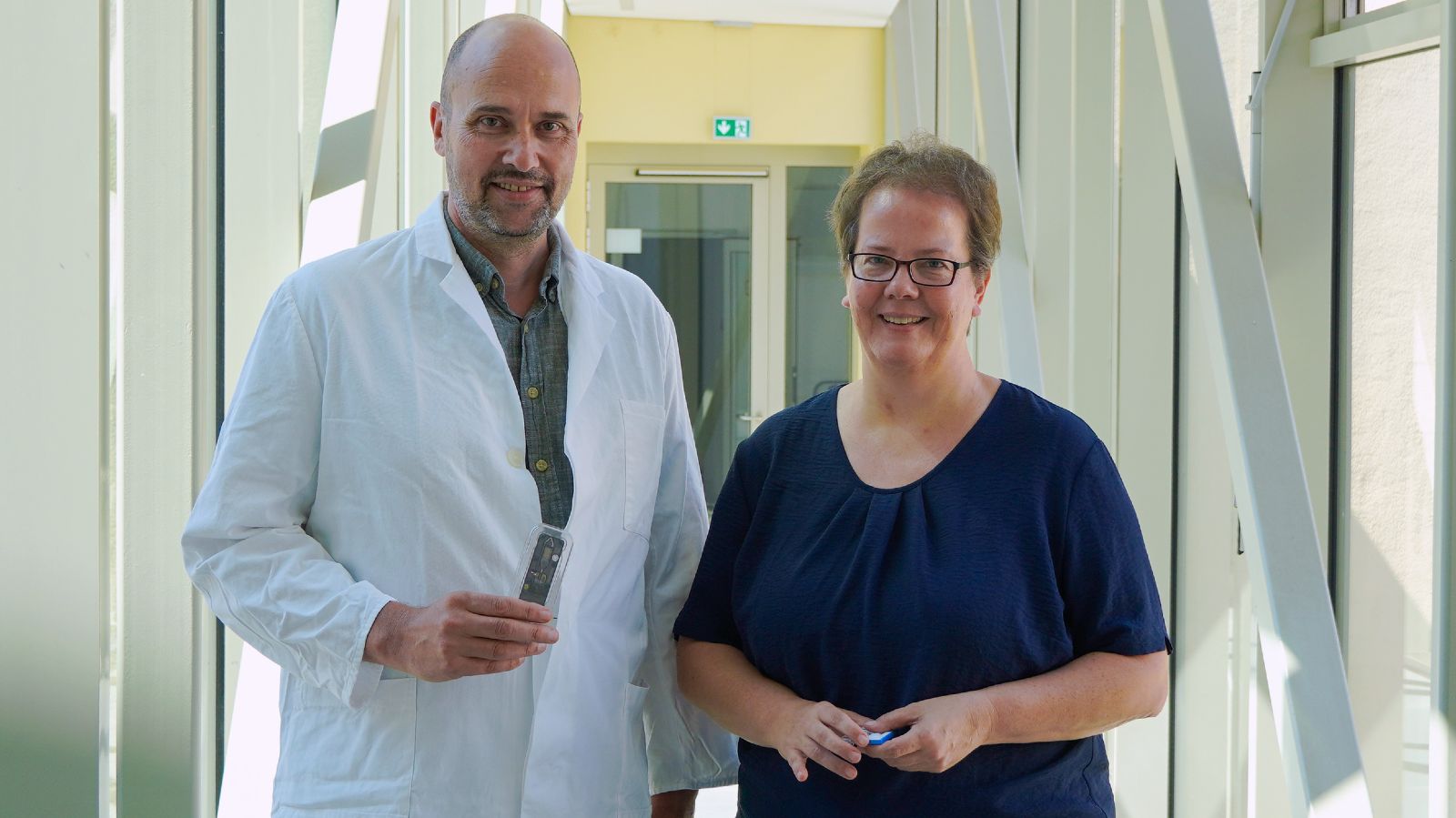
Professor Ralf Ehricht, 54 Jahre alt, ist Mikrobiologe und Biochemiker. Katrin Frankenfeld, 54 Jahre alt, hat Biotechnologie und Marketing studiert. Ehricht leitet eine Arbeitsgruppe am Leibniz-Institut für Photonische Technologien (Leibniz-IPHT). Frankenfeld leitet die Abteilung Biotechnologie bei der fzmb GmbH, dem Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechnologie. Beide sind seit etwa zehn Jahren beim Forschungscampus InfectoGnostics und entwickeln dort zusammen in einer Arbeitsgruppe ein Verfahren, das Schnelltests ermöglicht – einmal zur Prüfung des Impfstatus, einmal zur Erkennung von Antibiotikaresistenzen. Beide treibt es an, aus Forschungsergebnissen Produkte werden zu lassen.
Wie und warum sind Sie zum Forschungscampus InfectoGnostics gekommen?
Ralf Ehricht: Wenn ich zurückdenke, geht der Forschungscampus auf drei, vier Personen zurück. Ich saß damals mit an diesem Holztisch, als die Idee entstanden ist. Damals war ich noch bei Abbott, einem Diagnostik-Unternehmen, beschäftigt. Ich bin 2019 zurückgekommen an die Universität beziehungsweise das Leibniz-IPHT. Ich kenne also die Welt der Universitäten und die Welt der Unternehmen, die sich ganz wesentlich unterscheiden. Im Forschungscampus fülle ich jetzt eine Brückenfunktion aus. Meine Forschung ist translations- und produktorientiert.
Was bedeutet „Translation“ konkret?
Ralf Ehricht: Meine Definition von Translation ist: Ich kann es kaufen. Ich verstehe darunter nicht, dass etwas in zehn Jahren nützlich sein könnte – keine Konjunktive.
Katrin Frankenfeld: Dieser Translationsgedanke spielt bei uns, beim fzmb, eine große Rolle. Wir entwickeln Diagnostika unter anderem für Infektionskrankheiten und bringen diese in den Markt. Darum sind wir so froh, beim Forschungscampus InfectoGnostics dabei zu sein.
Woran arbeiten Sie beide genau am Forschungscampus InfectoGnostics?
Katrin Frankenfeld: An Multiparameterdiagnostik. Wir entwickeln Testverfahren, mit denen wir mit nur einer Probe gleichzeitig mehrere Dinge testen können. Aktuell beschäftigen wir uns mit dem Impfstatus. Der Arzt oder die Ärztin müsste den Impfstatus bezüglich Röteln, Mumps und anderer Krankheiten jeweils extra testen und die Proben in der Regel auch einschicken. In Zukunft soll das direkt in der Praxis möglich sein, ohne lange Wartezeiten.
Ralf Ehricht: Das funktioniert so ähnlich wie ein Corona-Test. Nur möchten wir nun auch von fünf anderen Viren wissen, ob sie in der Probe vorkommen – und vielleicht noch von sechs Bakterien. Das kann ich alles aus ein und demselben Töpfchen auslesen. Das hat große Vorteile: ökonomisch und zeitlich, aber auch den, dass wir alles unter den gleichen Rahmenbedingungen untersuchen.
Die Idee der minimalen Probe ist 2007 geboren, als ich mit meinem Kind in ärztlicher Behandlung war. Ich war regelrecht verärgert darüber, dass diesem kleinen Kind venöses Blut aus dem Kopfbereich genommen wurde. Ich dachte, das muss irgendwie besser gehen – und weshalb braucht es eine so große Menge an Blut für eine Probe?
Dabei prüfen Ärztinnen oder Ärzte in der Regel den bestehenden Impfschutz gar nicht. Die schauen sich den Impfausweis an und entscheiden anhand des Datums der letzten Impfung.
Katrin Frankenfeld (wirft ein): Es gibt ja viele Menschen, die nach Deutschland kommen, die keinen Impf-Pass haben. Da könnte man schon bei der Einreise den Impfschutz prüfen und falls nötig auch direkt impfen. Ohne Wartezeit und ohne externes Labor.
Ralf Ehricht: Aber Sie haben völlig recht, in der Regel schauen die Ärztinnen oder Ärzte in den Impfpass und impfen „drauf“. Also wenn zehn Jahre um sind, wird geimpft, weil beim Durchschnitt dann der Schutz nicht mehr gegeben ist. Dabei gibt es Impfungen, die bekommen wir alle zweimal, weil ein Teil der Menschen nicht auf die erste Impfung anspricht. Für die meisten Menschen würde eigentlich eine Impfung reichen. Da wäre es doch wunderschön, wenn man ein Test-Werkzeug hätte, mit dem man nicht nur feststellt, ob ein Impfschutz besteht, sondern für das als Probe auch ein kleiner Tropfen Blut aus der Fingerspitze reicht. Ein solcher Test kann im Übrigen auch bei Impfskepsis helfen, weil er die Diskussion versachlicht. Es gibt da ganz viele Anwendungsmöglichkeiten.
Katrin Frankenfeld: Wir nutzen jetzt schon die gleiche Technologie auch für Antibiotikaresistenzen. Da wollen wir mit einem anderen Schnelltest bestimmte Stoffe nachweisen, die dem Arzt oder der Ärztin einen Hinweis darauf geben, welches Antibiotikum er oder sie noch geben kann.
Ralf Ehricht: Die Probe ist dann praktisch ein Bakterium, was wir zum Beispiel aus einer Wunde gewonnen haben. In dem einen Fall schauen wir uns das Bakterium an und prognostizieren: gegen die Medikamente eins bis fünf bestehen Resistenzen, aber Medikament sechs bis acht kann der Arzt oder die Ärztin noch verordnen.
Dabei muss man bedenken: Es gibt tausende unterschiedliche Bakterien, die meisten sind nützlich. Es gibt mehrere hundert Krankheitserreger unter den Bakterien und gegen die gibt es (zum Glück!) unterschiedliche Antibiotika. Manche wirken gegen Bakterium 1, manche gegen Bakterium 2. Es gibt Resistenzen, die es in bestimmten Spezies immer schon gab (intrinsische Resistenzen) und Resistenzen, die erworben sind. Und die erworbenen schauen wir uns an.
Auch das passiert ja eher selten, dass auf Resistenzen getestet wird, bevor ein Antibiotikum verschrieben wird.
Ralf Ehricht: Bei der Technologie, die heute standardmäßig eingesetzt wird, dauert es bis zu 72 Stunden bis zum Test-Ergebnis. Wenn Sie aber zum Beispiel eine Sepsis haben, dann geht es um Zeit, dann brauchen Sie sofort ein Antibiotikum. Möglichst das Richtige. Das ist das eine, das zweite: Nicht jeder lebt in der westlichen Welt. Ein Test muss für alle bezahlbar sein. Denn egal an welchem Ort auf der Welt Resistenzen entstehen – sie werden sich über die ganze Welt verbreiten. 2019 sind mehr Menschen an den Folgen des Resistenzproblems gestorben als an Malaria. Ein aktuelles Problem ist, dass die Diagnostik von Antibiotikaresistenzen teurer ist als die Therapie Das gilt auch für das Überprüfen des Impfstatus. Das Prüfen ist manchmal teurer als die Impfung.
Katrin Frankenfeld: Wir wollen mit unserer Diagnostik schneller und billiger sein bei trotzdem hoher Sensitivität und Spezifität. Das ist das Ziel.

Herr Ehricht, sie haben vorhin gesagt, Translation heißt, man kann es kaufen? Wann ist das denn soweit? Wann kann mein Arzt oder meine Ärztin zum Beispiel den Schnelltest für den Impfstatus nutzen?
Ralf Ehricht: Dazu muss er erst durch den Zulassungsprozess. Wir legen im Forschungscampus den Grundstein dafür und schlagen die Brücke zum Produkt. Das gelingt, weil von Anfang an Unternehmen eingebunden sind. Diese Verzahnung ist wichtig. Die finalen Schritte durch den Zulassungsprozess zur Markteinführung erfolgen dann durch die Unternehmen. Unser Ziel ist, dass ein Unternehmen nach Abschluss eines Projekts direkt in die Zulassung gehen kann.
Katrin Frankenfeld: Wir sind noch im Entwicklungsstadium. Das wird also noch einige Jahre dauern. Fünf würde ich sagen. Die regulatorischen Anforderungen sind extrem hoch. Das ist natürlich auch gut so.
Und Ihr Unternehmen wäre möglicherweise daran interessiert, den Schnelltest zum Impfstatus in die Zulassung zu bringen?
Katrin Frankenfeld: Wären wir tatsächlich. Wir haben im Rahmen von diesem Projekt zunächst ein Gerät entwickelt, das solche Tests auslesen kann. Da sind wir jetzt schon dabei, dass sozusagen in den Markt zu bringen. Da haben wir die Entwicklungsarbeiten am Forschungscampus InfectoGnostics abgeschlossen und wir als fzmb treiben das jetzt an, dass das Lesegerät tatsächlich innerhalb des nächsten Jahres auf dem Markt ist. Das ist noch ein Haufen Arbeit, aber wir sind kurz vor dem Ziel.
Wie hilft da der Forschungscampus?
Katrin Frankenfeld: Die Möglichkeit für eine langfristige Entwicklung und Planung, wie sie der Forschungscampus ermöglicht, bietet viele Vorteile. Ich habe grundsätzlich diese fünf Jahresscheiben und darüber hinaus die Perspektive, mich über zwei, drei Förderperioden mit dieser Grund-Thematik zu beschäftigen. Das heißt, ich kann konsequent an einer Sache arbeiten und diese sehr weit voranbringen. Außerdem vereint der Forschungscampus eine große Interdisziplinarität und ganz viele verschiedene wissenschaftliche Ansätze, ganz viele verschiedene Technologien, die sozusagen zusammen an diesem Thema, in unserem Fall Infektionsforschung, arbeiten.
Inwiefern ist die Arbeit oder die Arbeitsatmosphäre am Forschungscampus anders als an der Universität oder im Unternehmen?
Katrin Frankenfeld: Man trifft auf ganz andere Leute, lernt ganz andere Technologien kennen, kommt mit ganz anderen wissenschaftlichen Ansätzen in Berührung. Du kochst nicht in deiner eigenen Suppe, sondern du erweiterst deinen Blick. Es gibt zum Beispiel am Forschungscampus ein besonderes Projekt, POCT-ambulant, das sich damit beschäftigt, wie Hausärzte diese Diagnostik, die wir entwickeln, anwenden würden. Eine solche Zusammenarbeit zwischen Forschungsprojekten ist nicht selbstverständlich. Wir legen die Tests den Hausärztinnen und Hausärzten vor und fragen, wie würdet ihr die anwenden, was würdet ihr verbessern? Das ist total super.
Ralf Ehricht: Ich habe hier alle Fachrichtungen, von Spektroskopie (Wissenschaft, die Licht oder andere Strahlen untersucht, um etwas über das herauszufinden, was sie absorbiert, reflektiert oder streut) und Ingenieurswissenschaften, über Chemie, Biologie und Bioinformatik bis hin zu Medizin, also auch Leute, die jeden Tag am Patienten arbeiten. Deswegen ist der Translationsgedanke so gut abgedeckt. Man kennt sich und jeder weiß vom anderen. Das gemeinsame übergreifende Thema ist wichtig. Und, das hat Frau Frankenfeld schön ausgeführt, dass es mal länger geht als zwei oder drei Jahre. Der Horizont ist dadurch ein anderer. Das zeigt sich jetzt nach zehn Jahren: Wir können auf wirklich viele tolle Ergebnisse zurückblicken.
Nehmen Sie etwas von der Art und Weise, wie im Forschungscampus gearbeitet wird, von dem, wie man Dinge angeht, mit in Ihre Mutterorganisation?
Ralf Ehricht: Es ist tatsächlich so, dass ich viele Erfahrungen in Gespräche mitnehme, in denen es um Umsetzung in gesellschaftlichen Nutzen geht. Es ist ganz häufig so, wenn ich in einer Runde sitze mit anderen Kolleginnen und Kollegen, dass ich den Forschungscampus als Beispiel nehme. Man nimmt praktisch die Erfahrung mit, die schon mal geklappt hat. Wenn man ehrlich ist, ist Wissenschaft ja oft eine Summe von Fehlschlägen. Aber das, was geklappt hat, ist sehr wertvoll und das implementiert man dann.
Katrin Frankenfeld: Also ich muss ehrlich sagen, dass der Translationsgedanke – also die Art und Weise wie der Forschungscampus agiert, gar nicht so weit weg ist, von dem, wie wir als Unternehmen sowieso ticken. Insofern wäre die Antwort auf Ihre Frage „nein“.
Aber sie profitieren insgesamt von dem Netzwerk?
Katrin Frankenfeld: Absolut. Zum Beispiel bei POCT-ambulant, da bekommen wir durch den Forschungscampus den Kontakt zu Ärztinnen und Ärzten. Das ist ein Unterschied, ob sich ein Forschungscampus an ein Hausärzte-Netzwerk wendet oder ob du es als Firma machst.
Sie haben vorhin von Fehlschlägen gesprochen, Herr Ehricht. Wie gehen Sie damit um?
Ralf Ehricht: Meistens mit dem Moment der Ruhe. Dann nehme ich mich eine Stunde raus und mache etwas ganz Anderes. Ich gehe Eis essen, Kaffee trinken oder ein Stück spazieren. Danach versuche ich das zu reflektieren. Ich male mir dann Entscheidungswege auf und dann bespreche ich das mit meinem Team. Ich rede jetzt nicht davon, wenn mal ein Experiment schiefgegangen ist. Das ist Alltag. Das ist: gesehen, gelacht, gestrichen, weiter. Aber so ein richtiger Tiefschlag, da muss man dann etwas schlucken.
Katrin Frankenfeld: Das stimmt. Eine Frustrationstoleranz muss jeder Forschende und jeder Entwickler, jede Entwicklerin haben oder lernen. Insbesondere Studierende, denn an der Uni klappen Experimente meist. Es ist aber wirklich selten, dass man in einer Sackgasse landet und überhaupt nicht mehr weiterkommt. Wenn etwas nicht klappt, ist man natürlich ein bisschen frustriert, aber das Forscher-Leben geht weiter. Ich habe immer viele Ideen im Kopf, dann wird eben etwas Anderes gemacht.
Wenn wir die andere Richtung schauen: Gab es einen Moment, über den Sie sich besonders gefreut haben?
Katrin Frankenfeld: Wenn wir ein Produkt haben, das fertig entwickelt ist und in den Markt geht, das ist toll. Wir eilen nicht dem Nobelpreis hinterher oder einer besonderen Publikation. Das sind wir einfach nicht. Für uns ist das eher produktorientiert, da sind wir dann auch stolz.
Ralf Ehricht: Als ich in dem Unternehmen gearbeitet habe und wir den ersten Microarray entwickelt haben. Ich glaube, das ist über doch längere Zeit schiefgegangen und wir hatten schon alle ziemlich aufgegeben. Als wir irgendwann nach einer Nachtschicht das Experiment gemacht haben und das Ergebnis unter dem Mikroskop zu sehen war, da haben wir gefeiert.
Wie würden Sie die Forschungscampuskultur beschreiben?
Katrin Frankenfeld: Die Kultur ist sehr offen und der Campus bietet einen geschützten Raum für den Austausch. Man verrät nicht die allertiefsten Geheimnisse, aber man kann ganz offen über seine Probleme diskutieren, auch über seine Erfolge natürlich. Es gibt Leute, die das mit einem teilen.
Ralf Ehricht: Ja, offen ist ganz wichtig. Lösungsorientiert würde ich noch sagen und kooperativ. Ohne Kooperation geht nix und daraus resultiert auch die Offenheit. Das ist ein schmales Brett, auf dem wir uns bewegen, zwischen Offenheit und Konkurrenz. Aber in der Zeit, in der wir jetzt im Forschungscampus arbeiten, kann ich mich an keinen Fall erinnern - bezogen auf die Inhalte des Forschungscampus, bei dem jemand gesagt hätte, so eine Idee kann ich nicht noch mal verraten, die hat jetzt mein Wettbewerber umgesetzt. Ich glaube, das umschreibt mit vielen Worten, was sie mit Kultur hinterfragen. Und am Ende ist es messbar, weil wir viele Partner haben, die alle bei der Stange geblieben sind. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass die Kultur den richtigen Weg zwischen Offenheit und Verschlossenheit bezüglich der Inhalte gefunden hat, die nämlich auch notwendig ist, damit Unternehmen mitmachen.
Katrin Frankenfeld: Das ist ja schon ein sehr lebendiges und gelebtes Netzwerk. Das hat mit der Langfristigkeit zu tun. Es entstehen neue Ideen im Netzwerk, auch über Projekte hinaus. Das ist der Vorteil vom Forschungscampus InfectoGnostics. Also, es macht tatsächlich Spaß. Oder sollte man das vielleicht lieber nicht schreiben? (lacht) Das klingt so unwissenschaftlich.
Ralf Ehricht: Ich denke, dass die Attraktion schon ziemlich klar umrissen ist: Wir haben eine Translations-Infrastruktur und die zieht maßgeblich Leute an, die das auch wollen. Du bleibst langfristig nicht dabei, wenn du eigentlich lieber Paper schreiben willst.

